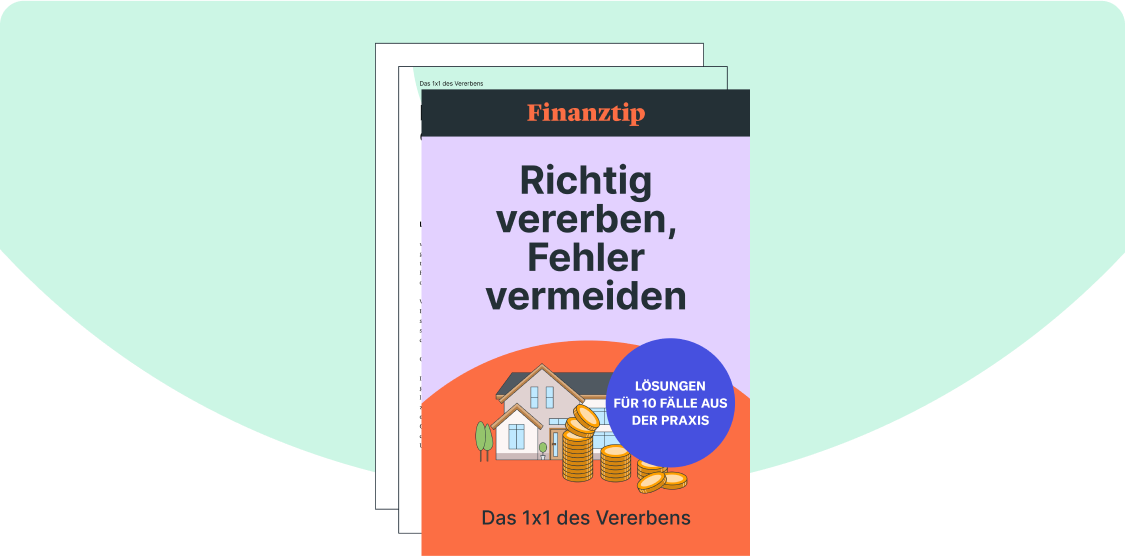Das Wichtigste in Kürze
- Die gesetzlichen Krankenkassen bieten verschiedene Wahltarife an.
- Je nach Tarif bekommst Du mehr Krankengeld, eine bessere Versorgung beim Hausarzt oder eine jährliche Beitragsrückerstattung.
- Manche Tarife lohnen sich, können aber Nachteile haben.
- Bei manchen Wahltarifen bist Du länger als ein Jahr an Deine Krankenkasse gebunden.
So gehst Du vor
- In unserem Krankenkassenvergleich 2025 haben HKK, TK und Audi BKK am besten abgeschnitten. Die BKK Firmus empfehlen wir für Preisbewusste, denen Zahnvorsorge sehr wichtig ist. Die Energie-BKK eignet sich für junge Familien und Schwangere.
- Wenn Du Dich entschieden hast, zu wechseln, melde Dich bei der neuen Krankenkasse an. Diese übernimmt für Dich die Kündigung Deiner alten Krankenkasse.
- Prüfe, ob sich der Abschluss eines Wahltarifs für Dich lohnt.
- Hole bei Deiner Krankenkasse Angebote für Wahltarife ein.
Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos
Die Gesetzliche Krankenkassen stehen unter finanziellem Druck. Die meisten Krankenkassen sind deshalb gezwungen, ihre Zusatzbeiträgen regelmäßig anzuheben. Für Dich bedeutet das: Such Dir eine Krankenkasse mit günstigem Beitrag und guten Leistungen. Wer zusätzlich sparen oder mehr aus seiner Krankenversicherung herausholen will, kann einen Wahltarif bei seiner Krankenkasse abschließen. Wir zeigen Dir, welche Wahltarife es gibt und welche sinnvoll sind.
Was sind Wahltarife der Krankenkassen?
Mit einem Wahltarif Deiner Krankenkasse kannst Du entweder bessere Leistungen oder sogar jährliche Prämien durch Deine Krankenkasse bekommen. Jede Krankenkasse bietet verschiedene Wahltarife an (§ 53 SGB V).
Manche Wahltarife muss jede Krankenkasse anbieten, wie den Krankengeld-Tarif und die hausarztzentrierte Versorgung.
Andere Wahltarife sind dagegen freiwillig. Zu den freiwilligen Angeboten gehören zum Beispiel ein Selbstbehalt oder eine Beitragsrückerstattung, wenn Du in einem Jahr nicht beim Arzt warst. Nähere Informationen zu den Wahltarifen erhältst Du weiter unten im Text.
Beachte: Für viele Wahltarife gilt eine Bindungsfrist von einem Jahr oder länger. In dieser Zeit kannst Du die Kasse nicht wechseln – es sei denn, diese erhöht den Zusatzbeitrag. Dann hast Du ein Sonderkündigungsrecht und kannst innerhalb von zwei Monaten zu einer anderen Krankenkasse wechseln. Beim Krankengeld-Tarif hast Du keine Möglichkeit, vor Ablauf der drei Jahre zu wechseln.
Was ist der Krankengeld-Tarif?
Selbstständige können bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Krankengeld-Tarif abschließen. Dieser Tarif ist für sie sehr sinnvoll, da sie keine Lohnfortzahlung wie Angestellte erhalten.
Als gesetzlich versicherter Selbstständiger kannst Du zwar Krankengeld bekommen, wenn Du eine sogenannte Wahlerklärung gegenüber Deiner Krankenkasse abgibst. Dann zahlst Du den regulären Beitragssatz von 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag (§ 44 Abs. 2 Nr. 2 SGB 5). Allerdings beginnt die Krankengeldzahlung erst ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit.
Brauchst Du schon früher Unterstützung, kannst Du ein Wahlkrankengeld bei Deiner Krankenkasse vereinbaren. Dann bekommst Du zum Beispiel schon ab dem 15. oder 22. Tag der Arbeitsunfähigkeit Krankengeld.
Mit dem Wahltarif kannst Du außerdem Dein reguläres Krankengeld ab dem 43. Tag erhöhen. Denn die Höchstgrenze für das gesetzliche Krankengeld liegt bei 128,63 Euro am Tag. Diese entspricht 70 Prozent der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze von 5.512,50 Euro in 2025 (§ 47 SGB 5). Liegen Deine Einnahmen darüber, benötigst Du in der Regel eine zusätzliche Absicherung.
Bei der Techniker Krankenkasse kannst Du zum Beispiel bis zu 230 Euro am Tag absichern. Beachte: Das kalendertägliche Krankengeld darf höchstens bei 70 Prozent Deiner regelmäßigen Einnahmen liegen.
Der monatliche zusätzliche Beitrag richtet sich danach, ab wann und wie viel Wahlkrankengeld Du vereinbarst. Die Preise kannst Du direkt bei Deiner Krankenkasse anfragen.
Beispiel: Bei der Techniker Krankenkasse bekommst Du im Tarif KG Klassik 22 Wahlkrankengeld ab dem 22. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Je fünf Euro Krankengeld kosten Dich 1,70 Euro. Ein Krankengeld von 100 Euro am Tag kostet bei der Techniker Krankenkasse daher 34 Euro im Monat.
Nachteile dieses Tarifs: Du bist drei Jahre an den Krankengeldtarif gebunden. Das Krankengeld ist außerdem der einzige Wahltarif, bei dem es kein Sonderkündigungsrecht gibt, wenn der Zusatzbeitrag steigt.
Alternativ kannst Du auch ein Krankentagegeld als private Zusatzversicherung abschließen. Dann bist Du beim Krankengeld an keine bestimmte Krankenkasse gebunden.
Außerdem kannst Du ein weitaus höheres Krankentagegeld wählen. Die Versicherer ermöglichen in der Regel die Absicherung Deines Nettoeinkommens minus Steuern.
Die Beiträge liegen aber meist deutlich über denen der gesetzlichen Krankenkasse. Ein Krankentagegeld von 100 Euro ab dem 22. Tag der Arbeitsunfähigkeit bekommst Du ab etwa 100 Euro im Monat.
Wann lohnen sich Selbstbehalt und Beitragsrückerstattung?
Ein Selbstbehalt und eine Beitragsrückerstattung der Krankenkassen lohnen sich nur, wenn Du weitestgehend gesund bist und selten zum Arzt gehst.
Selbstbehalt
Wählst Du einen Selbstbehalt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, musst Du einen Teil der Behandlungskosten selbst zahlen (§ 53 Abs. 1 SGB 5). Der Selbstbehalt gilt auch für Medikamente und Krankenhausbehandlungen. Bei Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen musst Du nichts zuzahlen. So einen Selbstbehalt kannst Du auch in der privaten Krankenversicherung abschließen.
Der Selbstbehalt ist höher als der mögliche Bonus. Die Selbstbeteiligung kann zum Beispiel bei 800 Euro im Jahr liegen. Die mögliche Prämie darf höchstens 600 Euro pro Jahr betragen. Die mögliche Prämie hängt bei vielen Kassen von der Höhe des Einkommens ab.
Zusammen mit einem anderen Wahltarif, der eine Prämienzahlung vorsieht, kann die Krankenkasse sogar bis zu 900 Euro im Jahr an Dich auszahlen. Denkbar ist eine Kombination aus Selbstbehalt und Beitragsrückerstattung. Diesen Wahltarif stellen wir Dir weiter unten vor.
Vorsicht: An einen Selbstbehalt-Tarif bist Du drei Jahre lang gebunden. Solltest Du in der Zwischenzeit krank werden und öfter zum Arzt müssen, musst Du den Selbstbehalt jedes Jahr aus eigener Tasche zahlen. In den drei Jahren kannst Du nur dann die Krankenkasse wechseln, wenn diese ihren Zusatzbeitrag erhöht.
Beispiele für Selbstbehalte bei den Krankenkassen
| Krankenkassen | Prämien | Selbstbehalt |
|---|---|---|
| Hkk | 500 € | 800 € |
| Techniker Krankenkasse | 300 € | 400 € |
| DAK | 600 € | 800 € |
| AOK Plus | 600 € | 120 € |
| Barmer | 450 € | 650 € |
Die Krankenkassen bieten verschiedene Selbstbehalt-Tarife an.
Quelle: Krankenkassen, Stand: 30. April 2025
Generell raten wir Dir, beim Selbstbehalt vorsichtig zu kalkulieren. Musst Du doch häufiger zum Arzt als erwartet, machst Du im schlimmsten Fall ein Minusgeschäft.
Beispiel: Du wählst einen Tarif mit 600 Euro Prämie bei 1.000 Euro Selbstbehalt. Brauchst Du im Jahr nur kleinere medizinische Behandlungen, für die Du 400 Euro zahlst, sparst Du 200 Euro. Kosten Deine Behandlungen jedoch mehr als 600 Euro, bekommst Du zwar die 600 Euro Prämie von der Kasse. Unterm Strich zahlst Du aber drauf.
Die Prämie der Krankenkasse hat einen weiteren steuerlichen Nachteil: Normalerweise kannst Du Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung als Sonderausgaben bei der Steuer angeben. Die Prämie sieht das Finanzamt als Beitragsrückerstattung. Dadurch kannst Du nur geringere Beiträge bei der Steuer absetzen.
Hinzu kommt, dass Du selbst bezahlte Arztrechnungen in der Regel nicht als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung absetzen kannst. So kann es passieren, dass der steuerliche Nachteil die Beitragsrückerstattung auffrisst.
Beispiel zur Auswirkung der Selbstbeteiligung
| vereinbarte Selbstbeteiligung | 800 € |
| Behandlungskosten übers Jahr | 400 € |
| Prämie der Krankenkasse | 500 € |
| Steuernachteil bei 42 Prozent Steuersatz | 210 € |
| verbleibende Ersparnis nach Steuerabzug | 290 € |
| abzüglich selbst bezahlter Behandlungskosten | = - 110 € |
Annahmen: Die Selbstbeteiligung kann nicht als Sonderausgaben abgesetzt werden.
Quelle: Finanztip-Berechnung, Stand: 8. Mai 2025
Beitragsrückerstattung
Wer ein Jahr lang nicht zum Arzt geht, bekommt von einigen Krankenkassen bis zu 600 Euro zurückerstattet. Solch eine Prämie zahlt zum Beispiel die Big direkt gesund.
Zu Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchen kannst Du dennoch gehen und trotzdem die Prämie abstauben. Im Gegensatz zum Selbstbehalt gehst Du bei diesem Modell kein finanzielles Risiko ein. Musst Du ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, entfällt nur die Beitragsrückerstattung.
Bedenke aber, dass Du durch die Beitragsrückerstattung geringe Beiträge zur Krankenversicherung bei der Steuer geltend machen kannst. Dadurch hast Du unter dem Strich weniger raus, als Dir die Krankenkasse überweist.
Du solltest Dich direkt bei Deiner Krankenkasse informieren, welche Beitragsrückerstattungen sie anbietet. Den Tarif schließt Du direkt bei Deiner Krankenkasse ab.
Bedenke aber die Nachteile: Schließt Du den Wahltarif zur Beitragsrückerstattung ab, bist Du mindestens ein Jahr an Deine Krankenkasse gebunden. Wechseln kannst Du nur, wenn diese ihren Zusatzbeitrag erhöht.
Was bringt die hausarztzentrierte Versorgung?
Im Hausarzttarif verpflichtest Du Dich, bei Beschwerden immer zuerst Deinen Hausarzt oder Deine Hausärztin aufzusuchen (§ 73 b SGB 5). Du benötigst eine Überweisung, wenn Du zum Facharzt oder zur Fachärztin gehen möchtest. Ausnahmen gelten für Besuche beim Zahnarzt, Augenarzt oder bei einer Gynäkologin.
Im Gegenzug genießt Du einige Vorteile: Dein Hausarzt muss Dir in der Regel wöchentliche Abendsprechstunden ermöglichen. Außerdem profitierst Du von kürzeren Wartezeiten beim Hausarzt von höchstens 30 Minuten. Die teilnehmenden Hausärzte verpflichten sich außerdem, an regelmäßigen Fortbildungen teilzunehmen.
Am besten fragst Du direkt bei Deiner Hausarztpraxis nach, ob sie an der hausarztzentrierten Versorgung teilnimmt. Dort kannst Du Dich auch im Hausarztmodell einschreiben. Im Nachgang bekommst Du von Deiner Krankenkasse die Vertragsunterlagen zugeschickt.
Entscheidest Du Dich für den Hausarzttarif, bist Du für ein Jahr an die Wahl Deines Hausarztes oder Deiner Hausärztin gebunden. Auch an die Wahl Deiner Krankenkasse bist Du für ein Jahr lang gebunden.
In der Regel kannst Du vier Wochen vor Ablauf des Jahres kündigen. Die Kündigungsfrist findest Du in den Vertragsunterlagen Deiner Krankenkasse. Eine Ausnahme gilt nur, wenn Deine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht: Dann hast Du ein Sonderkündigungsrecht und kannst früher zu einer anderen Kasse wechseln.
Neue Bundesregierung möchte Primärarztsystem einführen
Die neue Bundesregierung plant laut Koalitionsvertrag, dass jeder gesetzlich Versicherte zukünftig erst seine Hausarztpraxis aufsuchen soll. Diese entscheidet dann, ob Du zum Facharzt oder zur Fachärztin überwiesen wirst. Ausnahmen sollen gelten für die Augenheilkunde und die Gynäkologie. Dieses Primärarztsystem könnte den Hausarzttarif entbehrlich machen. Ab wann das Primärarztsystem gelten soll, steht allerdings noch nicht fest.
Wie funktioniert ein Kostenerstattungs-Tarif?
Der Wahltarif der Kostenerstattung funktioniert ähnlich wie in der privaten Krankenversicherung: Du zahlst Arztrechnungen zunächst selbst und reichst sie anschließend bei Deiner Krankenkasse ein (§ 13 Abs. 2 SGB 5).
Für die Arztpraxis wirst Du dadurch zum Privatpatienten und kommst in den Genuss von schnelleren Terminen, kürzeren Wartezeiten und privaten Leistungen. Du kannst Dich auch in einer Privatpraxis behandeln lassen.
Bei manchen Kassen kannst Du die Kostenerstattung auf bestimmte Bereiche wie Zahnbehandlungen oder Krankenhausaufenthalte begrenzen.
Doch Vorsicht: Die Kasse übernimmt in der Regel nicht die vollen Behandlungskosten. Sie erstattet in der Regel so viel, wie sie bei einer Abrechnung über die Gesundheitskarte gezahlt hätte. Den Rest musst Du aus eigener Tasche bezahlen. Außerdem erheben viele Kassen einen Abschlag für Verwaltungskosten in Höhe von fünf Prozent des Rechnungsbetrags.
Möchtest Du die Kostenerstattung nutzen, musst Du Deiner Krankenkasse vor der Behandlung Bescheid geben, zum Beispiel per E-Mail oder in der kasseneigenen App. An die Entscheidung bist Du für mindestens ein Quartal lang gebunden. Das bedeutet: In dieser Zeit musst Du alle Kosten beim Arzt zunächst selbst vorstrecken.
Bevor Du Dich für eine bestimmte Behandlung entscheidest, solltest Du mit dem Arzt und der Krankenkasse klären, in welcher Höhe die Krankenkasse die Kosten erstattet.
Unser Rat: Möchtest Du private Leistungen beim Zahnarzt oder im Krankenhaus nutzen, dann prüfe, ob eine Zahnzusatzversicherung oder eine Krankenhaus-Zusatzversicherung für Dich in Frage kommt. Den gesetzlichen Anteil kann der Arzt oder die Ärztin direkt über die Gesundheitskarte abrechnen. Mehrkosten für Zahnimplantate oder für das Einbettzimmer im Krankenhaus bekommst Du von Deiner Zusatzversicherung erstattet.
Welche Wahltarife gibt es für chronisch Kranke?
Für chronisch kranke Menschen bieten die Krankenkassen zwei verschiedene Wahltarife an: die besondere integrierte Versorgung und strukturierte Behandlungsprogramme.
Informationen zu den Angeboten bekommst Du direkt bei Deiner Krankenkasse. Einen ersten Eindruck kannst Du Dir meistens auf der Website der Krankenkasse verschaffen.
Besondere integrierte Versorgung
Die besondere oder integrierte Versorgung (§ 140 a SGB 5) soll Dir eine möglichst gute Versorgung bei bestimmten Erkrankungen garantieren. Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten bei Fachärzten sollen vermieden werden.
Dazu haben die Krankenkassen Verträge mit Spezialisten, also Ärzten, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen abgeschlossen. Nimmst Du an der besonderen Versorgung teil, koordinieren Dich die behandelnden Ärzte und Ärztinnen durch die gesamte Behandlung. Du musst nicht erst nach dem richtigen Spezialisten suchen.
Beispiel: Der teilnehmende Facharzt überweist Dich in eine Universitätsklinik, in der ein Spezialist für Deine Erkrankung arbeitet. Nach der Behandlung oder Operation leitet Dich die Klinik an eine spezialisierte Reha-Einrichtung weiter. Ärzte und Behandler tauschen alle Befunde und Untersuchungsergebnisse untereinander aus.
Die integrierte Versorgung bietet sich vor allem bei schweren oder chronischen Erkrankungen an: zum Beispiel Herzerkrankungen, Rheuma, Krebs oder wenn Du ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk benötigst.
Möchtest Du, dass Deine Diagnosen und Behandlungen besser zwischen verschiedenen Ärzten und Einrichtungen abgestimmt werden, kann die elektronische Patientenakte, kurz: ePA, für Dich sinnvoll sein. Deine Krankenkasse hat Anfang 2025 automatisch eine ePA für Dich angelegt, außer Du hast widersprochen. Wie Du die ePA richtig nutzt und was Du tun musst, wenn Du sie nicht möchtest, erfährst Du im Ratgeber zur elektronischen Patientenakte.
Strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke
Chronisch kranke Menschen können sich für die Teilnahme an einem strukturierten Behandlungsprogramm entscheiden (§ 137 f SGB 5). Andere Begriffe dafür sind Disease-Management-Programm (DMP) oder Chroniker-Programm.
Geeignet sind diese Programme für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Brustkrebs, Asthma oder Osteoporose.
In diesen Programmen behandeln Dich Ärzte und Ärztinnen nach bestimmten medizinischen Leitlinien. Diese Leitlinien werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt. Das ist ein Gremium, das festlegt, welche medizinischen Leistungen von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden.
Ärzte verschiedener Fachrichtungen arbeiten zusammen, stimmen die Behandlungsschritte ab und führen regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch. So sollen chronisch Kranke besser und koordinierter versorgt werden.
Informationen zu strukturierten Behandlungsprogrammen bekommst Du direkt bei Deiner Krankenkasse.
Wie findest Du eine passende Krankenkasse?
Bevor Du Dich für einen bestimmten Wahltarif bei einer Krankenkasse entscheidest, solltest Du Beiträge und Leistungen der Krankenkassen vergleichen. Entscheidest Du Dich für eine günstige Krankenkasse, kannst Du bis zu mehreren Hundert Euro im Jahr sparen. Mit guten Zusatzleistungen wie einer kostenlosen professionellen Zahnreinigung oder einem Zuschuss zu osteopathischen Behandlungen kannst Du zusätzlich sparen.
Die besten Krankenkassen in unserem Vergleich der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) sind die HKK, TK und Audi BKK. Diese Kassen haben in unserer Preis-Leistungs-Bewertung am besten abgeschnitten. Daneben empfehlen wir die BKK Firmus für Preisbewusste, die viel Wert auf Zahnvorsorge legen. Die Energie-BKK eignet sich für junge Familien und Schwangere.
Wir haben die Leistungen von 17 bundesweiten Krankenkassen untersucht, darunter besonders günstige, leistungsstarke und besonders große Kassen. Die detaillierten Ergebnisse kannst Du in der Tabelle unten einsehen. Einzelheiten zu den Leistungen der Krankenkassen findest Du im jeweiligen blauen Info-i in der Vergleichstabelle.
Die Krankenkassen im Finanztip-Vergleich
Weitere Themen
- Vorsorgeuntersuchungen
- Wer hilft bei Ärger mit der Krankenkasse
- Brille von der Krankenkasse
- Energie-BKK
- Übergangsgeld
- BKK VBU Krankenversicherung
- Freiwillig in der GKV bleiben
- Arzneimittel-Zuzahlungsbefreiung
- Krankenversicherung der Rentner
- Zusatzbeitrag der Krankenkassen
- Nachgehender Leistungsanspruch
- Krankenversicherung der HEK
- Krankenversicherung der TK
- GKV-Familienversicherung
- Kinderkrankengeld
- Krankenkassenbeitrag auf Abfindung
- Krankenversicherung bei der Audi BKK
- Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL)
- BKK Firmus
- Big direkt gesund Krankenkasse
- Widerspruch Krankenkasse
- Krankenversicherung der IKK Classic
- Reha beantragen
- Krankenversicherungspflicht
- Kündigung und Wechsel der GKV
- Bürgerversicherung
- Verdienstgrenzen Familienversicherung
- Krankenversicherung der HKK
- Krankengeld
- Härtefallregelung Zahnersatz
- Krankengeld für Selbstständige
* Was der Stern bedeutet:
Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.
Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).
Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.
Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.
Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.